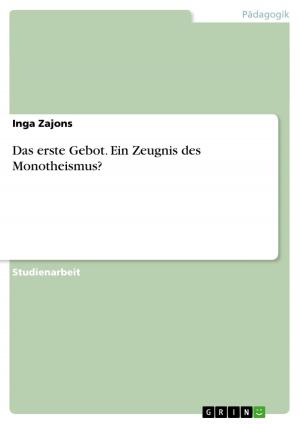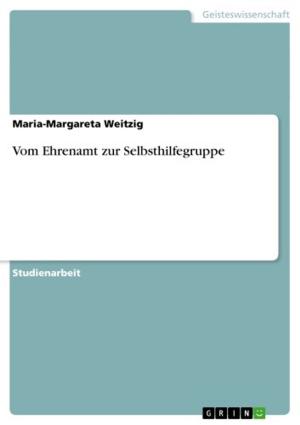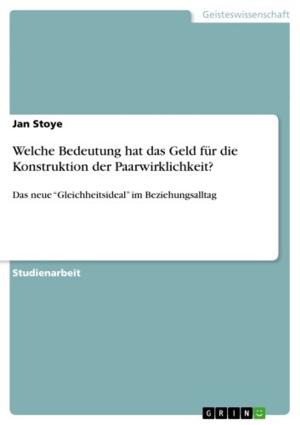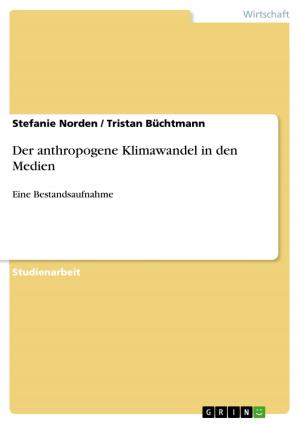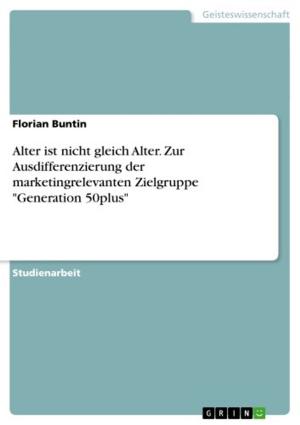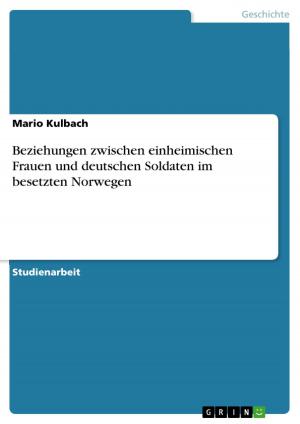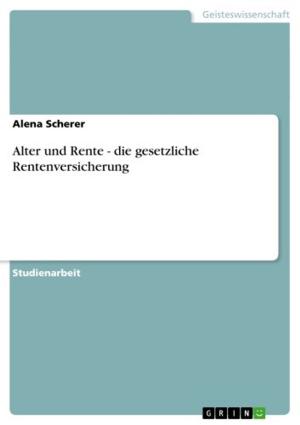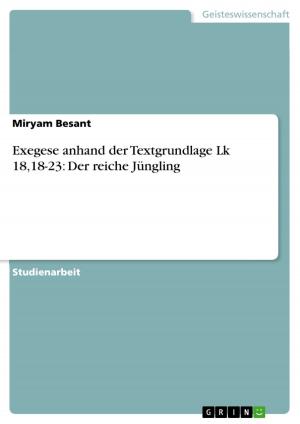Die Bestimmungen des Westfälischen Friedens im Hinblick auf Konfessionen und die Reichsverfassung
Nonfiction, History, Modern| Author: | Stephanie Günther | ISBN: | 9783656368083 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | February 6, 2013 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Stephanie Günther |
| ISBN: | 9783656368083 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | February 6, 2013 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Neuere Geschichte, Note: 1,0, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Veranstaltung: Der Westfälische Friede von Münster und Osnabrück, Sprache: Deutsch, Abstract: Am 24. Oktober 1648 wurde offiziell in Münster der Westfälische Frieden unterzeichnet. Mit ihm sollte zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges nicht nur das zukünftige Verhältnis des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zum Ausland, insbesondere Schweden und Frankreich, sondern vor allem reichsinterne Probleme geregelt werden. Der Westfälische Friede ist also als 'Religions-, National- und Völkerfrieden in einem' zu sehen. Er sollte eine äußerst unruhige Phase in der Geschichte des Reiches, die mit Luthers Thesenanschlag 1517 begonnen hatte, beenden. Die von Luther in Bewegung gesetzte Reformation sorgte für Auseinandersetzungen zwischen Staaten, Landständen und ihren Fürsten und zwischen Reichsstädten und dem Kaiser. Die Reformation wurde zu einer politischen Bewegung, deren Parteien immer stärker in Konflikt zueinander gerieten. 1531 bildeten die evangelischen Reichsstände den Schmalkaldischen Bund und traten damit in offene Opposition zum Kaiser. Dies führte 1546/7 zum sogenannten Schmalkaldischen Krieg in Süd- und Mitteldeutschland, den der Kaiser für sich entscheiden konnte. Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 hatte man versucht, die zwischen den Konfessionen herrschenden Spannungen in den Griff zu bekommen. Dies war nicht gelungen. Aber in der Zeit von 1555 bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 spitzte sich die Lage weiter zu. Der Protestantismus verbreitete sich immer mehr und spaltete sich selbst wiederum in Lutheraner und Calvinisten. Der Katholizismus reagierte darauf mit der Gegenreformation. Während dieser Entwicklungen schafften es die Landesherren unbehelligt vom Reich ihre Territorialherrschaft zu festigen. Die lutherische Auffassung der Landesfürsten als weltliche Obrigkeit stützte ihre Position. Die zunehmenden Spannungen zwischen den Konfessionsparteien entluden sich im Dreißigjährigen Krieg. Mit dem Westfälischen Frieden sollte 1648 eine Regelung getroffen werden, die einerseits akzeptiert und eingehalten wurde und andererseits dafür sorgte, dass die Ordnung im Reich wieder hergestellt wurde und das Leben normal weitergehen konnte. Die in Münster und Osnabrück ausgehandelten Teilverträge sollten die Konfessionsstreitigkeiten im Reich beenden und das Verhältnis der Stände zum Reich und zum Kaiser festlegen. Damit waren Veränderungen in der Verfassung des Reiches verbunden. Er wurde und wird deshalb auch als Grundgesetz bzw. Verfassung des Reiches bezeichnet.
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Neuere Geschichte, Note: 1,0, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Veranstaltung: Der Westfälische Friede von Münster und Osnabrück, Sprache: Deutsch, Abstract: Am 24. Oktober 1648 wurde offiziell in Münster der Westfälische Frieden unterzeichnet. Mit ihm sollte zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges nicht nur das zukünftige Verhältnis des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zum Ausland, insbesondere Schweden und Frankreich, sondern vor allem reichsinterne Probleme geregelt werden. Der Westfälische Friede ist also als 'Religions-, National- und Völkerfrieden in einem' zu sehen. Er sollte eine äußerst unruhige Phase in der Geschichte des Reiches, die mit Luthers Thesenanschlag 1517 begonnen hatte, beenden. Die von Luther in Bewegung gesetzte Reformation sorgte für Auseinandersetzungen zwischen Staaten, Landständen und ihren Fürsten und zwischen Reichsstädten und dem Kaiser. Die Reformation wurde zu einer politischen Bewegung, deren Parteien immer stärker in Konflikt zueinander gerieten. 1531 bildeten die evangelischen Reichsstände den Schmalkaldischen Bund und traten damit in offene Opposition zum Kaiser. Dies führte 1546/7 zum sogenannten Schmalkaldischen Krieg in Süd- und Mitteldeutschland, den der Kaiser für sich entscheiden konnte. Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 hatte man versucht, die zwischen den Konfessionen herrschenden Spannungen in den Griff zu bekommen. Dies war nicht gelungen. Aber in der Zeit von 1555 bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 spitzte sich die Lage weiter zu. Der Protestantismus verbreitete sich immer mehr und spaltete sich selbst wiederum in Lutheraner und Calvinisten. Der Katholizismus reagierte darauf mit der Gegenreformation. Während dieser Entwicklungen schafften es die Landesherren unbehelligt vom Reich ihre Territorialherrschaft zu festigen. Die lutherische Auffassung der Landesfürsten als weltliche Obrigkeit stützte ihre Position. Die zunehmenden Spannungen zwischen den Konfessionsparteien entluden sich im Dreißigjährigen Krieg. Mit dem Westfälischen Frieden sollte 1648 eine Regelung getroffen werden, die einerseits akzeptiert und eingehalten wurde und andererseits dafür sorgte, dass die Ordnung im Reich wieder hergestellt wurde und das Leben normal weitergehen konnte. Die in Münster und Osnabrück ausgehandelten Teilverträge sollten die Konfessionsstreitigkeiten im Reich beenden und das Verhältnis der Stände zum Reich und zum Kaiser festlegen. Damit waren Veränderungen in der Verfassung des Reiches verbunden. Er wurde und wird deshalb auch als Grundgesetz bzw. Verfassung des Reiches bezeichnet.